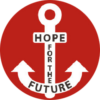Anfang Juni 2025 feierte die Plattform gegen Ausbeutung und Menschenhandel ihr zehnjähriges Bestehen. Ein ganzer Tag war dem zivilgesellschaftlichen Engagement gewidmet – mit einem Programm, das eindrucksvoll zeigte, wie weit die Zivilgesellschaft im Kampf gegen Ausbeutung und Menschenhandel gekommen ist. Gleichzeitig wurde deutlich, wie groß die Herausforderungen nach wie vor sind. Vertreter:innen aus Politik, Verwaltung, internationalen Organisationen sowie engagierte Einzelpersonen kamen zusammen, um Bilanz zu ziehen, aktuelle Entwicklungen zu diskutieren und Perspektiven für die Zukunft zu formulieren.

Zentrale Leitfragen
Im Mittelpunkt der Diskussionen stand die Frage: Wie können wir sicherstellen, dass Opfer von Menschenhandel nicht nur kurzfristig geschützt, sondern langfristig in die Gesellschaft integriert werden? Die Antworten kreisten um zwei miteinander verknüpfte Säulen: den Zugang zu Aufenthaltsgenehmigungen und zu Arbeitsmärkten. Beide Faktoren entscheiden darüber, ob Opfer gestärkt werden und eine Zukunftsperspektive erhalten – oder ob sie weiterhin in einem Zustand der Gefährdung verharren.
Erkenntnisse aus zehn Jahren Monitoring

Nach über einem Jahrzehnt systematischer Beobachtung in 47 Vertragsstaaten der Konvention liegt heute eine Fülle an Daten und Analysen vor. Sie zeigen klar, welche Maßnahmen Wirkung entfalten – und wo Staaten hinter ihren Verpflichtungen zurückbleiben. Die Muster sind eindeutig:
- Länder mit soliden Aufenthaltstitelsystemen schaffen nicht nur Sicherheit für Betroffene, sondern stärken zugleich ihre eigenen Strukturen im Kampf gegen Menschenhandel.
- Staaten, die den Zugang zu Aufenthaltstiteln und Arbeitsmärkten erschweren, riskieren, dass Betroffene erneut in Abhängigkeiten geraten oder der Justiz fernbleiben.
Die Bilanz der GRETA-Studien (Gruppe von Expert:innen für Maßnahmen gegen Menschenhandel des Europarats) unterstreicht, dass der Aufenthaltsstatus die Grundlage für Sicherheit, Stabilität und Zugang zur Justiz bildet – einschließlich des Rechts auf Entschädigung.
Zwischen Fortschritt und Lücken
Das Übereinkommen gibt den Mitgliedsstaaten eine gewisse Flexibilität bei der Umsetzung. Diese Offenheit hat einerseits vielversprechende Praktiken hervorgebracht – etwa Modelle, die Betroffenen unmittelbaren Zugang zu Arbeit und Ausbildung gewähren. Andererseits sind auch erhebliche Lücken sichtbar geworden.
Die umfassende Analyse zeigt:
- Einige Staaten erfüllen die Mindeststandards nur formal, ohne tatsächlich praktikable Wege für Betroffene zu eröffnen.
- In mehreren Ländern existieren nach wie vor restriktive Hürden, die verhindern, dass Opfer ihre Rechte wahrnehmen können.
- Der politische Wille ist entscheidend: Wo er vorhanden ist, entstehen funktionierende Schutzmechanismen – wo er fehlt, bleiben Rechte auf dem Papier.
Im Rahmen der Tagung berichtet eine GRETA-Expertin, dass trotz zunehmender rechtsgerichteter und teilweise autoritärer Tendenzen in europäischen Staaten die GRETA-Besuche und Evaluierungen weiterhin ernst genommen werden. Die Länder beantworten Fragebögen, nehmen an Gesprächen teil und zeigen Bemühungen zur Verbesserung, nicht zuletzt aufgrund von Gruppendruck. Gleichzeitig beobachtet sie interne Spannungen, da das Komitee der Vertragsparteien Druck auf die Experten ausübt, etwa Fragebögen zu vereinfachen. GRETA bleibt jedoch unabhängig und verpflichtet, Empfehlungen auszusprechen, auch wenn politische Entwicklungen das Umfeld zunehmend herausfordernder machen könnten.
Zahlen und ernüchternde Realitäten
Die detaillierte Auswertung liefert ein gemischtes Bild. Während einzelne Staaten vorbildliche Lösungen entwickelt haben, zeigen die Zahlen in vielen Ländern erhebliche Defizite. Sie erzählen die Geschichte einer Umsetzung, die zu langsam voranschreitet und allzu oft hinter den menschenrechtlichen Verpflichtungen zurückbleibt.
Integrationsparadox und Schutzdefizite
- In der Schweiz ist eine „Integrationsleistung“ Voraussetzung für Aufenthaltstitel – viele Opfer erhalten jedoch keinen Zugang zu den dafür nötigen Angeboten.
- In Belgien ist der Aufenthalt streng an Strafverfahren gebunden – scheitern diese, endet auch der Schutz.
- Solche Mechanismen widersprechen dem menschenrechtlichen Anspruch, den Schutz an die Bedürfnisse der Opfer zu knüpfen, nicht an äußere Bedingungen.
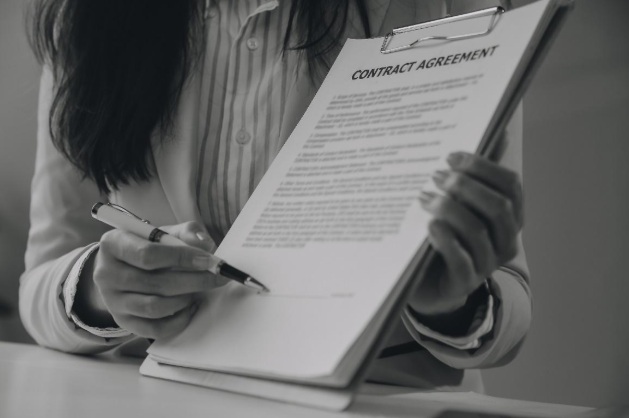
Umsetzung der neuen EU-Richtlinie
Die 2024 verabschiedete EU-Richtlinie gegen Menschenhandel verpflichtet die Mitgliedsstaaten bis Juli 2026 zu umfassenden Reformen:
- Sicherstellung von Unterkunft, materieller Unterstützung und Arbeitsmarktzugang.
- Einführung formaler Verweisungsmechanismen für grenzüberschreitende Fälle.
- Straffreiheit für Opfer, die bisher wegen Ordnungswidrigkeiten (illegale Arbeit, Prostitution, Betteln) kriminalisiert wurden.
Die Umsetzung wird entscheidend sein, um die bisherigen Lücken zu schließen – bleibt aber vom politischen Willen abhängig.
Politische Rahmenbedingungen
Die Evaluierungen zeigen: Wo der politische Wille vorhanden ist (z. B. Dänemark im Umgang mit Geflüchteten aus der Ukraine), sind schnelle und umfassende Schutzmaßnahmen möglich. Doch der wachsende Einfluss rechtspopulistischer und autoritärer Regierungen birgt jedoch das Risiko, dass Standards abgeschwächt oder Empfehlungen ignoriert werden. GRETA beobachtet diese Entwicklung mit Sorge.
Fazit
Die bisherigen Erfahrungen machen deutlich: Opfer von Menschenhandel in Europa erhalten nach wie vor sehr ungleichen Schutz. Fehlende oder verspätete Aufenthaltsgenehmigungen, eingeschränkter Arbeitsmarktzugang und restriktive Verfahren halten viele in Abhängigkeit und Unsicherheit.
Die dringendsten Aufgaben sind:
- Einführung humanitärer Alternativen zu rein kooperationsabhängigen Aufenthaltstiteln.
- Verbindliche Zeitrahmen für Entscheidungen, um monatelange Wartezeiten zu verhindern.
- Garantierter Zugang zum Arbeitsmarkt und Qualifizierungsangebote für Betroffene.
- Beseitigung bürokratischer Hürden wie Dokumentationspflichten, die Opfer nicht erfüllen können.
- Umfassende Umsetzung der neuen EU-Richtlinie bis 2026, um europaweit Mindeststandards durchzusetzen.
Die Zukunft hängt entscheidend davon ab, ob Staaten ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen ernst nehmen und Opfern von Menschenhandel den Schutz gewähren, der ihnen zusteht – nicht nur formal, sondern tatsächlich im Alltag. Es wird deutlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Organisationen und zivilgesellschaftlichen Akteur:innen erheblich gestärkt werden muss, um gemeinsam Druck auf Staaten auszuüben und wirksame Maßnahmen durchzusetzen. Erfolg wird nur dann möglich sein, wenn unmissverständlich klar wird, dass Menschenhandel ein globales Problem ist, unter dem die gesamte Menschheit leidet, und dass es inakzeptabel ist, dass nur wenige davon profitieren.
#Ausbeutung #GRETA #Bilanz #Schutz #AgainstHumanTrafficking #GegenMenschenhandel #EndExploitation #EndTrafficking #HopeForTheFuture #Österreich