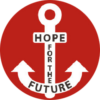Der globale Kampf gegen Menschenhandel und moderne Sklaverei benötigt Führungspersönlichkeiten, deren Fachwissen und Perspektiven auf eigenen Erfahrungen basieren: Die Überlebenden selbst. Ihr Mut, ihre Widerstandsfähigkeit und ihre tiefen Einblicke sind entscheidend für die Entwicklung wirksamer Richtlinien und Programme. Doch trotz ihres Fachwissens und Engagements stoßen „Survivor Leaders“ und die von ihnen geführten Organisationen oft auf erhebliche Hindernisse, insbesondere beim Zugang zu Ressourcen, was ihre Fähigkeit zu nachhaltiger und wirkungsvoller Advocacy-Arbeit einschränkt

Die unverzichtbare Rolle der Überlebenden in der Advocacy-Arbeit
Überlebende sind nicht nur unverzichtbar im Kampf gegen Menschenhandel, sondern bringen auch eine authentische und glaubwürdige Perspektive in die Advocacy-Arbeit ein. Ihre einzigartigen Einblicke und Erfahrungen sind von unschätzbarem Wert bei der Gestaltung wirksamer Maßnahmen in der Bekämpfung des Menschenhandels. Ihr Wissen aus erster Hand über die Taktiken der Menschenhändler*innen, die Herausforderungen während und nach der Ausbeutung sowie die Lücken in bestehenden Unterstützungssystemen kann zu reaktionsfähigeren und wirkungsvolleren Richtlinien und Initiativen führen.

Überlebende engagieren sich aus vielfältigen Gründen in der Advocacy-Arbeit: ihre persönlichen Erfahrungen, ein starkes Gerechtigkeitsempfinden, der Wunsch nach Veränderung und sogar die Heilung, die diese Arbeit ihnen bietet. Sie nutzen verschiedene Strategien, um auf nationaler und lokaler Ebene Einfluss zu nehmen, darunter:
- Direkte Advocacy: Persönliche Interaktionen mit Politikern und Interessengruppen.
- Basis Mobilisierung: Mobilisierung von Gemeinschaften durch Kampagnen, Petitionen und lokale Veranstaltungen.
- Legislative Advocacy: Arbeit an der Änderung oder Schaffung von Gesetzen zum besseren Schutz von Opfern und zur Rechenschaftspflicht von Tätern.
- Medienarbeit: Nutzung verschiedener Plattformen zur Sensibilisierung und Verbreitung von Geschichten von Überlebenden.
- Öffentlichkeitsarbeit: Aufklärung der Öffentlichkeit bei Konferenzen, Schulen und Gemeinschaftsveranstaltungen, um das Thema greifbarer zu machen.
Die Einbeziehung von Überlebenden in politische Entscheidungsprozesse stellt sicher, dass die umgesetzten Maßnahmen nicht nur effektiv, sondern auch empathisch und auf die Bedürfnisse der Betroffenen zugeschnitten sind. Dieser Ansatz verschiebt die Erzählung von der bloßen Betrachtung von Überlebenden als Opfer ohne Handlungsfähigkeit hin zur Anerkennung ihrer Rolle als mächtige Akteure des Wandels. Laut dem Trafficking in Persons (TIP) Report 2023 haben Länder wie Kanada, Australien und die Philippinen bereits Plattformen für regelmäßige Konsultationen zwischen Überlebenden und Anti-Trafficking-Akteuren geschaffen, um ihre Perspektiven in Gesetzgebung und Praxis zu integrieren. Auch der ASEAN Multi-Sectoral Work Plan Against Trafficking in Persons (Bohol TIP Work Plan 2.0) befürwortet die Einrichtung nationaler Beiräte oder Ausschüsse, die Überlebende einschließen, um deren Erfahrungen und Erkenntnisse zur Gestaltung effektiverer Politiken zu nutzen.
Ein Teufelskreis der Unterfinanzierung und Missverständnisse
Trotz ihrer entscheidenden Rolle stehen Überlebende und ihre Initiativen vor gewaltigen Hürden, die ihre Fähigkeit zu sinnvoller und nachhaltiger Advocacy-Arbeit einschränken:
- Erschreckende 47 % der Überlebenden nutzen ihre eigenen persönlichen Mittel, um ihre Advocacy-Arbeit zu finanzieren. Die erhaltenen Zuschüsse sind oft begrenzt und decken selten die tatsächlichen Betriebs- und Advocacy-Kosten ab.
- Die Prioritäten für die Finanzierung werden oft von den Geldgebern und nicht von den Überlebenden selbst bestimmt. Dies führt dazu, dass wesentliche Bedürfnisse, wie z.B. Mittel für Transport (71% der Überlebenden benötigen dies) oder Lebensmittel (60% benötigen diese), unbeachtet bleiben.
- 70 % der befragten Überlebenden empfanden Anträge als kompliziert und bürokratisch. Solche Prozesse erfordern oft Vorwissen oder erhebliche administrative Kapazitäten, die kleineren, von Überlebenden geführten Organisationen fehlen.
- Gelder unterstützen oft nur kurzfristige oder krisenbezogene Arbeit, was die langfristige Wirkung und die Bekämpfung der Grundursachen des Menschenhandels einschränkt. Dies führt zu Unsicherheit und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Betriebs.
- Finanzierungen enthalten oft keine Bestimmungen für den Aufbau von Kapazitäten, sondern bieten nur ergebnisorientierte Finanzierung an.

- Überlebende werden oft eher als Begünstigte statt als Führungskräfte wahrgenommen. Vorurteile über die Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit von Überlebenden führen dazu, dass deren Organisationen oft weniger Chancen erhalten als etablierte Dritte.
- Es besteht ein Mangel an Vertrauen seitens der Geldgeber, der dazu führt, dass Überlebende nicht selten ihre eigenen finanziellen Mittel oder persönliche Vermögenswerte einsetzen müssen.
- Geldgeber erwarten oft traditionell quantitative Daten (z.B. Anzahl der „geretteten Überlebenden”), während qualitative Bewertungen, die sich auf Erfahrungen und Ergebnisse konzentrieren, ebenso als Erfolgsmaßstäbe anerkannt werden müssen. Der traditionelle „Rettungsansatz“ kann Stigmatisierung verstärken.
- Viele Geldgeber stellen strenge Förderkriterien auf (z.B. Mindestanzahl von Betriebsjahre oder Vermögen), die neue, von Überlebenden geführte Initiativen ausschließen.
- Überlebende kämpfen oft mit sozialem Selbstvertrauen, körperlicher oder psychischer Gesundheit aufgrund ihres Traumas, was Flexibilität und trauma-informierte Unterstützung erfordert.
- Viele Überlebende haben keinen Zugang zu etablierten Netzwerken und Ressourcen in der Advocacy- und Philanthropie-Gemeinschaft.
- Die Verfügbarkeit von Fördergeldern ist begrenzt, und oft stehen sie Überlebenden nicht direkt zur Verfügung, sondern nur über Dritte.
- Die Komplexität moderner Sklaverei erfordert nuanciertere Metriken und einen menschenzentrierten Ansatz anstatt die Reduzierung von Überlebenden auf Zahlen.
- Überlebende fühlen sich manchmal gezwungen, ihre traumatischen Erfahrungen auf eine Weise zu teilen, die ihre Geschichten ausbeutet oder den Erwartungen der Geldgeber entspricht, was ihre Würde untergraben kann.
Wege nach vorne
Um die Zugänge zum Handeln für Überlebende zu verbessern, sind flexible und uneingeschränkte Finanzierung, umfassende Kapazitätsaufbauprogramme, vereinfachte Prozesse, kollaborative und ethische Partnerschaften sowie angemessene Vergütung und Unterstützung unerlässlich. Die Förderung der Basisarbeit und der globale Wissensaustausch können Organisationen von Überlebenden weltweit stärken.
Indem diese Empfehlungen umgesetzt werden, kann der Anti-Sklaverei-Bewegung geholfen werden, „Zugang zu Maßnahmen zu schaffen“, die eine kollektive Bewegung mobilisieren und dauerhafte Veränderungen im Kampf gegen den Menschenhandel bewirken. Es ist nicht nur von Vorteil, sondern notwendig für den Erfolg von Bemühungen, die Stimmen der Überlebenden zu erheben und sicherzustellen, dass sie am Tisch sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden.
#Organisationen #Überlebende #Zugang #Unterfinanzierung #Erfolg #Maßnahmen #Barrieren #Förderung #Advocacy #AgainstHumanTrafficking #GegenMenschenhandel #EndExploitation #EndTrafficking #HopeForTheFuture #Österreich