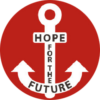Seit 2022 gilt Kambodscha als Brennpunkt einer wachsenden Menschenrechtskrise, die mit einem globalen Phänomen verknüpft ist, das vielen nur oberflächlich bekannt ist: Spam-Anrufe, betrügerische SMS oder Phishing-E-Mails. Was oft als lästige Alltagserscheinung abgetan wird, hat eine düstere Kehrseite. Hinter vielen dieser digitalen Betrugsversuche stehen hochorganisierte Netzwerke – und ein System moderner Ausbeutung. Tausende Arbeitsmigrantinnen und -migranten aus Asien, darunter auch Minderjährige, wurden mit dem Versprechen gut bezahlter Jobs nach Kambodscha gelockt. Statt einer regulären Beschäftigung erwartet sie Zwangsarbeit: In stark gesicherten Anlagen werden sie festgehalten, misshandelt und gezwungen, betrügerische Online-Aktivitäten durchzuführen – jene, die am Ende weltweit auf unseren Bildschirmen landen.
Das Versprechen und die Falle: Wie Menschen in die Sklaverei gelockt werden
Die Opfer, die aus Ländern wie China, Thailand, Malaysia, Bangladesch, Vietnam, Indonesien, Taiwan und Äthiopien stammen, werden mit Versprechungen von gut bezahlter Arbeit in seriösen Berufen wie der Verwaltung oder als Ingenieure angelockt. Lisa (Name geändert), eine 18-jährige Thailänderin, wurde eine Stelle in der Verwaltung mit hohem Gehalt und Bildern eines Hotels mit Swimmingpool versprochen, doch diesen sah sie nie. Stattdessen wurden sie und andere von Menschenhändlern nachts über einen Fluss nach Kambodscha gebracht und in Betrugsanlagen, sogenannten Scamming Compounds, festgehalten.
Die Rekrutierung erfolgt häufig über soziale Medien, wobei die Stellenanzeigen vage gehalten sind und ungewöhnlich hohe Gehälter versprechen. Die Transportkosten werden oft von den Rekrutierern oder Compound-Managern übernommen, die dann in eine nicht rückzahlbare Schuld umgewandelt werden. Viele Opfer werden über irreguläre Migrationsrouten ins Land gebracht, überqueren Flüsse oder Dschungel, ohne Grenzkontrollen zu passieren, was ihre Verletzlichkeit erhöht. Es gibt gut etablierte Netzwerke von Menschenhändlern, die Opfer innerhalb Kambodschas zwischen den Compounds transportieren, oft unter dem Vorwand, sie würden zu Polizeistationen gebracht.

Gefangen in einem lebendigen Alptraum: Menschenrechtsverletzungen in den Compounds
Einmal in den Compounds, beginnt der wahre Albtraum. Diese verfügen über physische und organisatorische Sicherheitsmerkmale, die denen von Gefängnissen ähneln. Dazu gehören hohe Mauern mit Stacheldraht oder Klingendraht, bewachte Tore, zahlreiche Sicherheitskräfte, Überwachungskameras und Gitter oder Käfige an den Fenstern. Überlebende beschreiben diese Orte als „Gefängnis“ und sagten, eine Flucht sei „unmöglich“.
Die in diesen Compounds begangenen Menschenrechtsverletzungen sind massiv und überlappen sich oft:
- Zwangsarbeit und erzwungene Kriminalität:

Unter Androhung von Gewalt werden die Betroffenen zu Online-Betrügereien gezwungen, wie „Pig-Butchering„-Scams, bei denen Opfer emotional manipuliert werden, um dann finanziell ausgebeutet zu werden. Viele erhalten keinerlei Bezahlung für ihre Arbeit, oder die Löhne liegen weit unter dem Versprochenen. Überstunden werden als Strafe eingesetzt, und Arbeitszeiten von über 10 Stunden täglich, manchmal sogar über 16 Stunden, sind die Norm. Die erzwungene Kriminalität macht die Opfer noch abhängiger, da ihnen bei Fluchtversuchen gedroht wird, die kriminellen Aktivitäten den Behörden zu melden.
- Folter und andere Misshandlungen:
Die Betroffenen erleiden Folter, Misshandlungen oder werden Zeugen dieser.
Die Gewalt, die fast immer von Compound-Managern oder „Bossen“ verübt wird, dient der Kontrolle, Disziplinierung und der Erzielung maximaler Arbeitsleistung. Viele Compounds haben spezielle „dunkle Räume“, die ausschließlich der Bestrafung dienen. Häufig verwendete Werkzeuge sind Elektroschockstäbe, Handschellen und Schusswaffen. Die Anwendung von Elektroschockwaffen ist inhärent missbräuchlich und kann schwere Leiden bis zum Tod verursachen.
- Sklaverei:
Der vollständige Kontrollverlust, den die Compound-Chefs über die Überlebenden ausüben, kommt der Ausübung von Eigentumsrechten gleich. Überlebende berichten, in die Compounds verkauft worden zu sein, Zeuge des Verkaufs anderer gewesen zu sein oder von Managern mit dem Verkauf an andere Compounds bedroht worden zu sein. Auch wenn der Begriff „Verkauf“ nicht immer verwendet wurde, deutet die erzwungene Verlegung zwischen Compounds und die Tatsache, dass die Betroffenen gezwungen waren, Schulden abzuzahlen, die willkürlich erhöht wurden und unbezahlbar waren, auf eine moderne Form der Sklaverei hin. Überlebende berichteten von einem ständigen Klima der Angst.
Die Mitschuld des Staates: Warum die Krise weitergeht
Trotz umfassender Berichte von Journalisten und NGOs sowie Tausender Rettungsaktionen hat die kambodschanische Regierung es grob versäumt, angemessene Schritte zur Beendigung dieser Menschenrechtsverletzungen zu unternehmen. So stellt die NGO Amnesty International ein Muster gescheiterten staatlichen Verhaltens fest, das auf Duldung und Komplizenschaft bei den Menschenrechtsverletzungen hinweist:
- Ineffektive Ermittlungen:
Von insgesamt 53 identifizierten Compounds wurden nur zwei nach staatlicher Intervention geschlossen. Über ein Drittel führt die Missbräuche nach Polizeieinsätzen fort. Interventionen sind oft reaktiv und oberflächlich; die Polizei trifft Manager an den Toren, statt die Compounds zu betreten und gründlich zu ermitteln.

- Korruption und Absprachen:
Es gibt Hinweise auf systematische Korruption und Absprachen zwischen Compound-Chefs und der kambodschanischen Polizei. Überlebende berichteten, dass ihre Fluchtversuche oder Kontakte zur Polizei von den Chefs entdeckt wurden, was zu Bestrafungen führte. Einige der Überlebenden sind überzeugt davon, dass die Polizei Informationen an die Compounds weitergab.
- Mangelnder Opferschutz:
Die kambodschanischen Behörden versäumen es, Opfer des Menschenhandels angemessen zu identifizieren und zu schützen. Nach ihrer „Rettung“ werden viele Opfer über Monate in „gefängnisähnlichen“ Einwanderungshaftanstalten unter schlechten Bedingungen festgehalten und müssen für grundlegende Bedürfnisse wie Essen und Wasser selbst aufkommen. Ihnen wird keine rechtliche oder psychologische Unterstützung zuteil.
- Versäumnis bei der Regulierung:
Die Regierung hat es versäumt, den Erwerb und die Verwendung von Elektroschockstäben zu verbieten, obwohl diese als primäres Folterinstrument in den Compounds dokumentiert wurden. Auch die Regulierung privater Sicherheitsfirmen ist unzureichend; Sicherheitskräfte in den Compounds tragen verbotene Waffen wie Schusswaffen und Elektroschockstäbe.
- Angriffe auf unabhängige Medien:
Journalisten und Menschenrechtsverteidiger, die über die Betrugsanlagen berichten, werden bedroht und verhaftet. Das Nachrichtenportal Voice of Democracy (VoD) wurde 2023 geschlossen, was als Vergeltung für seine Berichterstattung über die Betrugskrise angesehen wird.
Um dem anhaltenden System digitaler Zwangsarbeit ein Ende zu setzen, bedarf es entschlossener Maßnahmen – sowohl von der kambodschanischen Regierung als auch der internationalen Gemeinschaft. Ohne wirksame Ermittlungen, Strafverfolgung und den Schutz der Opfer droht der „lebendige Albtraum“ für tausende Menschen weiter Realität zu bleiben.
#Ausbeutung #ModerneSklaverei #Kambodscha #Regierung #NGOs #Menschenrechtskrise #Phising #Betrugsmaschen #digitaleBetrugsversuche #AgainstHumanTrafficking #GegenMenschenhandel #EndExploitation #EndTrafficking #HopeForTheFuture #Österreich