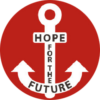Jujutsu Kaisen, One Piece, Attack on Titan und Pokémon – die Anime-Branche ist heute größer denn je. Die japanischen Zeichentrickfilme und -serien, die einst lediglich einer Nischen-Subkultur vorbehalten waren, haben sich längst zu einem globalen Millardenmarkt weiterentwickelt. Allein 2023 wurde ihr Wert auf rund 21 Milliarden Dollar geschätzt. Selbst Streaming-Giganten wie Netflix, Prime Video oder Crunchyroll überbieten sich mittlerweile mit eigenen Produktionen, um von diesem Boom zu profitieren. Doch hinter dem internationalen Hype verbirgt sich eine dunkle Realität, denn in der Anime-Branche herrschen teils katastrophale Arbeitsbedingungen vor.

Animator:innen und Synchronsprecher:innen am Existenzminimum

Trotz des weltweiten Erfolgs der Anime-Industrie, leben die Animator:innen – die das Ganze überhaupt erst möglich machen – unter prekären Bedingungen, wie ein Bericht der Vereinten Nationen (UN) zeigt. Denn trotz des kommerziellen Erfolges ihrer Arbeiten liegen die jährlichen Einstiegsgehälter von Animator:innen nach wie vor bei lediglich 1,5 Millionen Yen. Das sind umgerechnet rund 9.000 Euro. Besonders erschreckend ist die Tatsache, dass 30,8 Prozent (Stand 2023) der Beschäftigten als Freiberufler:innen oder freie Dienstnehmer:innen tätig sind und dadurch keinen Schutz durch die geltenden Arbeitsgesetze in Japan genießen. Die Folge? Niedrige Löhne, übermäßig lange Arbeitszeiten, unbezahlte Überstunden, kurze oder keine Pausenzeiten, enormer Zeit- und Leistungsdruck, kaum Wertschätzung und ein Leben am Existenzminimum. Wenn all diese Probleme nicht angegangen werden, warnt der UN Bericht davor, dass die Branche vor einem möglichen Zusammenbruch stehen könnte.
Auch Synchronsprecher:innen (sogenannte “Seiyuus”) verdienen trotz ihres hohen Wiedererkennungswerts oft nur wenig, besonders zu Beginn ihrer Karriere. Ihr Einkommen richtet sich nach einem festen Rangsystem: Einsteiger:innen im „Junior-Rang“ erhalten pro Anime-Episode lediglich um die 15.000 Yen (ca. 120 Euro). Der Verdienst steigt mit jedem der 30 folgenden Ränge nur geringfügig um 1.000 Yen (ca. 8 Euro), sodass selbst auf dem höchsten Rang der Stufe A maximal 45.000 Yen (ca. 360 Euro) pro Episode erreicht werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Rolle eine Haupt- oder Nebenfigur betrifft oder wie erfolgreich der Anime ist – das Einkommen richtet sich ausschließlich nach dem aktuellen Rang des Seiyuus.
Für einen typischen Anime mit zwölf Episoden ergibt sich so im besten Fall ein Einkommen von rund 1.440 Euro über einen Zeitraum von drei Monaten. Je nach Anzahl der Rollen, die Synchronsprecher:innen gleichzeitig übernehmen können, schwankt das Gehalt jedoch stark. Zusätzlich behalten Agenturen in der Regel 20 % des Einkommens ein, während weitere 20 % durch Steuern abgezogen werden. Im ungünstigsten Fall bleiben so nur etwa 80 Euro pro Woche zum Leben übrig. Hinzu kommt, dass Banken aufgrund des unregelmäßigen Einkommens oft keine Kredite gewähren. Viele müssen Nebenjobs annehmen oder werden von ihren Familien unterstützt, um überhaupt in der Branche Fuß zu fassen.
Die Ursachen sind vielseitig
Die Ausbeutung von Arbeitskräften in der Anime-Industrie hat tief verwurzelte strukturelle Ursachen, die bis in die 1960er Jahre zurückgehen. Schon mit dem Erfolg von Astro Boy im Jahr 1963 etablierte sich ein Industriestandard, der auf wöchentliche 30-Minuten-Folgen mit engen Deadlines setzte. Um diese Fristen einzuhalten, griff man auf Outsourcing, sprich die Auslagerung von Arbeitsprozessen oder -schritten an externe Dienstleister, zurück.
Moderne Anime-Produktionen werden in der Regel von sogenannten Produktionskomitees finanziert – Zusammenschlüsse aus Verlagen, Spielzeugfirmen und anderen Unternehmen. Diese Komitees legen das Budget fest und teilen sich die Gewinne. Die eigentlichen Produktionsfirmen wiederum lagern große Teile der Arbeit an kleinere Studios und Agenturen aus, die ihrerseits weitere Subunternehmer und Freiberufler beauftragen. Durch dieses Kettenmodell wird das finanzielle Risiko verteilt, aber auch die Einnahmen – oft bleibt am Ende kaum etwas für die eigentlichen Kreativen übrig. Die Bezahlung kann sich monatelang verzögern oder sogar ganz ausbleiben.
Viele Arbeitsverhältnisse in der Branche entstehen informell, häufig über Telefon oder Messaging-Apps – ohne schriftliche Verträge oder klare Regelungen zur Bezahlung. Das führt dazu, dass viele Beschäftigte gar nicht wissen, wie viel sie verdienen werden – oder ob sie überhaupt bezahlt werden. Zwar verlangt eine neue Gesetzgebung in Japan seit Kurzem schriftliche Verträge und eine Zahlung innerhalb von 60 Tagen, doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Zudem sind, im Gegensatz zu anderen Ländern, Gewerkschaften in der japanischen Anime-Branche kaum vertreten.
Trotz der schlechten Bezahlung und den harten Arbeitsbedingungen träumen viele Menschen schon seit ihrer Kindheit davon, in der Anime-Welt zu arbeiten. Diese Leidenschaft wird von der Industrie ausgenutzt. Viele junge Künstlerinnen und Künstler sind bereit, unter unwürdigen Bedingungen zu arbeiten, in der Hoffnung, irgendwann eine besser bezahlte Position zu erreichen. Doch solche Stellen sind selten, und der Konkurrenzdruck bleibt hoch.
Japan ergreift Maßnahmen
Der UN-Bericht hat weltweit große Wellen geschlagen. Aufgrund der zunehmenden Kritik, ergreift die japanische Regierung nun über die Japan Fair Trade Commission (JFTC) konkrete Maßnahmen um gegen diese Ausbeutung vorzugehen.
Online-Formular eingerichtet
Unter anderem hat die JFTC am 29. Januar 2025 auf ihrer Website ein Formular eingerichtet, über welches Arbeiter:innen aus der Film- und Anime-Industrie Fälle von Ausbeutung und/oder schlechten Arbeitsbedingungen melden können. Der Generalsekretär der JFTC, Tetsuya Fujimoto, kommentierte: „Es wurde uns zugetragen, dass die Gewinne [aus Anime- und Filmproduktion] nicht ausreichend an die Produktionsstätte weitergegeben werden”. Besonders erhofft sich die JFTC Informationen unter anderem im Bezug auf folgende Probleme:

- Fehlen von Arbeitsverträgen
- Unverhältnismäßig niedrige Bezahlung
- Ungerechtfertigte Auftragsstornierungen ohne Vergütung
- Unvergütete Nachkorrekturen
- Unangemessene Zeitpläne
Die Behörde hat einen öffentlichen Aufruf an Kreativschaffende im Unterhaltungsbereich gestartet, solche Praktiken zu melden, und plant, die gewonnen Erkenntnisse spätestens Ende 2025 zu veröffentlichen. Ob und wie viele der Betroffenen sich tatsächlich an die Behörde wenden bleibt abzuwarten.
#Ausbeutung #ModerneAusbeutung #Japan #Anime #StopptAusbeutung #FinanzielleAusbeutung #Aufklärung #AgainstHumanTrafficking #GegenMenschenhandel #EndExploitation #EndTrafficking #HopeForTheFuture #Österreich